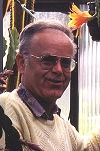Als in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Phyllokakteenzucht begann, standen gelb bl├╝hende Hybriden noch v├Âllig au├čerhalb der erreichbaren M├Âglichkeiten. Dies war auch gar nicht anders zu erwarten, denn mit der rosafarbenen 'Nopalxochia phyllanthoides' (DC.) Br. & R., der scharlachroten Nopalxochia ackermanii(Haw.) Knuth und dem karminroten 'Heliocereus speciosus' (Cavan.) Br. & R. standen zun├Ąchst nur Pflanzen als Kreuzungspartner zur Verf├╝gung, in deren Bl├╝ten ein mehr oder weniger kr├Ąftig rotes Pigment zur Ausbildung kommt, das zudem noch ausgesprochen dominant vererbt wird. Die aus den ersten Anf├Ąngen hervorgegangenen bigenerischen Prim├Ąrhybriden unterschieden sich in ihren Bl├╝ten somit nur geringf├╝gig voneinander: sie waren durchweg rot, mal heller, mal dunkler, mit meist deutlich ausgepr├Ągtem Karminanteil, der als bl├Ąulicher Schimmer die R├Ąnder der Petalen zierte.

Bild 1: ┬┤Verano┬┤
Dies ├Ąnderte sich grundlegend, als um 1840 herum das innen rahmfarbene, au├čen gr├╝nlich- bis gelblich-wei├č bl├╝hende Epiphyllum crenatum (Lind!.) G. Don. nach Europa kam, das wenig sp├Ąter eingekreuzt wurde, und als weitere Stammart unserer Phyllos f├╝r eine deutliche Erweiterung der Farbenvielfalt sorgte. In diesem Zusammenhang sind besonders die beiden franz├Âsischen Z├╝chter Charles Simon und Lorenzo Courant zu erw├Ąhnen, die viele neuartige Hybriden kreierten, deren Farbskala nun auch die hellen T├Âne einschloss, die von wei├č mit und ohne gelblicher oder gr├╝nlicher Komponente ├╝ber vielerlei rosa und lachsfarbene Abstufungen bis ins Orangerote reichten. Der erstgenannte Z├╝chter war es mit gro├čer Wahrscheinlichkeit auch, dem etwas sp├Ąter der denkw├╝rdige Schritt gelang, Epiphyllum crenatum mit der popul├Ąren "K├Ânigin der Nacht" Selenicereus grandiflorus (L.) Br. & R.) und der nicht minder bekannten "Prinzessin der Nacht" ('Selenicereus pteranthus' (Lk. & 0.) Br. & R.) zu kreuzen. Die hieraus resultierende Hybridgattung wurde gut 100 Jahre sp├Ąter von Gordon Rowley als x Seleniphyllum (= Epiphyllum x Selenicereus) g├╝ltig beschrieben, und einzelne Gartenformen aus ihr, allen voran die Sorten "Cooperi" und die sehr ├Ąhnliche "Pfersdorffii" '( siehe Nachtrag 2009 )', haben bis in die heutigen Tage hinein weltweite Verbreitung gerade auch bei Nicht-Kakteenfreunden erfahren, f├╝r die die sehr gro├čen und stark duftenden wei├č-gelblichen Bl├╝ten eine willkommene Bereicherung zu den ebenfalls sehr beliebten roten und rosa Blumen eines "Schusterkaktus" (= x Heliochia violacea bzw. vandesii) oder 'Alatus' (= Nopalxochia phyllanthoides 'Deutsche Kaiserin') darstellten. Man erkennt jene Z├╝chtungen auch im bl├╝tenlosen Zustand leicht an ihrem kompakten Habitus und den gestielten, fast glattrandigen, im Neutrieb rotbraunen, sp├Ąter graugr├╝nen Flachsprossen, die vorzugsweise unten, aus den runden, hell beborsteten "Stengeln" heraus bl├╝hen. Allein die sich zun├Ąchst langsam entwickelnden, sp├Ąter bei W├Ąrme rasant gr├Â├čer werdenden, spitzen, sehr lang gestreckten gelben Knospen mit bronzefarbenen H├╝llbl├Ąttern sind schon beeindruckend genug, und die bis 25 cm breiten und mitunter ├╝ber 30 cm langen Bl├╝ten stehen an Sch├Ânheit denen der 'K├Ânigin' oder 'Prinzessin' nur wenig nach, halten daf├╝r aber mit 2-3 Tagen und N├Ąchten wesentlich l├Ąnger.

Bild 2: ┬┤Marge Cocke┬┤
Diese beiden Hybriden sowie eine Anzahl weiterer Blendlinge, die entweder sp├Ąter auf ├Ąhnliche Machart oder aber durch Kreuzungen untereinander bzw.
durch R├╝ckkreuzungen nach Epiphyllum crenatum hin entstanden, bilden eine spezielle Gruppe f├╝r sich innerhalb der Phyllokakteen, die Altmeister
W. O. Rother einst "Cooperi Klasse" nannte. Sie alle haben mehr oder weniger stark duftende, gro├če Blumen, die innen ├╝berwiegend reinwei├č, gelegentlich auch
cremefarben, au├čen von gr├╝nlich wei├č ├╝ber differenzierte Bronzet├Âne bis hin zu gelb gef├Ąrbt sein k├Ânnen. Diese Sorten wurden ob ihrer g├╝nstigen Eigenschaften
bis in die j├╝ngste Vergangenheit unz├Ąhlige Male als Kreuzungspartner f├╝r die Weiterzucht benutzt, und in manch einer gro├čbl├╝tigen, manchmal auch duftenden
Gartenform verbirgt sich die Abstammung einer "Cooperi" / "Pfersdorffii", obgleich ihr bunter, schillernder Flor dies nicht so ohne weiteres vermuten l├Ąsst.
Mit der Entstehung der Neuen "Cooperi Klasse" wurde zum ersten Mal der Wunsch nach gelbbl├╝tigen Pflanzen laut. Die Phyllo Zucht hatte in relativ kurzer
Zeit eine Vielzahl von Bl├╝tenfarben, -formen und -gr├Â├čen geschaffen, und es fehlten eigentlich nur noch blaue und gelbe Bl├╝ten, wobei Erstere jedoch wegen
des v├Âlligen Fehlens von Anthozyanen 1) bei Kakteen sowieso ein Wunschtraum bleiben m├╝ssen 2). Durch das Einkreuzen von Heliocereus speciosus
tritt jedoch dessen typischer stahlblauer Farbschimmer bei sehr vielen Bastarden in so ausgepr├Ągter Form auf, dass rein blaue Bl├╝ten kaum vermisst werden.
Die Abwesenheit von gelben Blumen wurde dagegen als echter Mangel empfunden, da diese Farbe, die von vielen Menschen als sehr angenehm empfunden wird, bei Kakteen
sehr h├Ąufig anzutreffen ist, nur eben bei den Phyllos bisher nicht. Was lag also n├Ąher, sich in der Zucht gelber Bl├╝ten zu versuchen, wobei als
Ausgangsmaterial eigentlich nur die Hybriden der "Cooperi-Klasse" in Frage kamen, wo bei einigen Sorten ja schon ein recht kr├Ąftiges Gelb zu vermerken war,
wenn auch vorerst nur beschr├Ąnkt auf den Kranz der ├Ąu├čeren Kronbl├Ątter, w├Ąhrend sich das innere Perigon noch durchweg in Wei├č bis Crem pr├Ąsentierte. Rother
(1921) gar berichtete in seinem "Praktischen Leitfaden" von einer "Cooperi", die im Zimmer buttergelbe (also hellgelbe) Blumen "von wunderbarer Pracht" brachte,
um ein paar Tage sp├Ąter im Freien dann aber leuchtend wei├č zu erbl├╝hen, nachdem sie in den vorhergehenden Jahren stets ein zartes Crem gezeigt hatte.
So spricht einiges daf├╝r, dass es nur eine Frage der Zeit zu sein schien, bis man auch gelbe Sorten zur Verf├╝gung hatte. Dennoch haben sich in der Folgezeit
Generationen von Phylloz├╝chtern vergeblich bem├╝ht, dieses Ziel zu erreichen. In der Literatur sowie in Pflanzenlisten und Katalogen der damaligen Zeit tauchten
zwar immer wieder einmal Namen von gelbbl├╝tigen Phyllos auf, aber diese waren - wenn ├╝berhaupt - nur wenig besser als die o.a. Ausgangsformen. Sorten wie 'Wrayi'
(Courant), 'Tettaui' (Simon) 3), 'Franzisco' (Nicolai), 'Luna' (Bornemann) und vor allem 'Deutschland' (Knebel) galten lange Zeit als Beste in dieser Kategorie,
aber dies war, wie gesagt, immer noch ziemlich unbefriedigend, da sie f├╝r gew├Âhnlich innen halt mehr oder weniger wei├č, ausnahmsweise auch einmal etwas mehr
ins Gelbliche gehend bl├╝hten.

Bild 3: Epikaktus ┬┤Olympic Gold┬┤
So war es dann auch eine kleine Sensation, als die beiden Z├╝chter Paul Fort und Garland O'Barr, Besitzer des einst bei Insidern wohlbekannten
"Country Garden" in Manhattan Beach nahe Los Angeles, im Jahre 1957 die ersten "echten" gelben Phyllokakteen vorstellten, n├Ąmlich 'Reward', 'Discovery' und
'Golden Fleece'. Sie gingen hervor aus einer Kreuzung, die in ├Ąhnlicher Form wohl schon oft zuvor durchgef├╝hrt worden war, und von der man dieses Ergebnis
nicht so ohne weiteres erwarten durfte:
'Thorinne' (kr├Ąftig rot mit karminviolett) x 'Madonna' (wei├č, au├čen gelb), die "Mutter" mit einiger Wahrscheinlichkeit eine x Heliochia-Gartenform
(Nopalxochia x Heliocereus), der "Vater" mit ziemlicher Sicherheit ein Angeh├Âriger aus der Cooperi Verwandtschaft.
Diese Kreuzung erwies sich als ├╝beraus erfolgreich, denn neben den drei genannten, hei├č ersehnten Sorten stehen weitere Geschwisterpflanzen aus diesem
Schwarm bei Phyllofreunden hoch im Kurs wegen ihrer guten vegetativen Eigenschaften und ihrer Bl├╝hfreudigkeit. Erwartungsgem├Ą├č sind in der bunten Farbpalette
der Blumen rote bis orangefarbene T├Ânungen mit unterschiedlichem Karminanteil reichlich vertreten, aber es gibt auch etliche Nachkommen, bei denen alle
Schattierungen von reinem Wei├č bis hin zum Gelb in differenzierten ├╝berg├Ąngen vorkommen. Viele bleiben, wohl als Erbe der "Cooperi", in ihren Ausma├čen eher
bescheiden, kommen also Liebhabern mit beengten Verh├Ąltnissen entgegen, und auch sonst sind sie sehr variabel, wof├╝r die oben genannten gelben Sorten ein gutes
Beispiel abgeben, die sich trotz ├Ąhnlicher Pigmentierung klar voneinander unterscheiden. Der Gelbfaktor ist bei 'Reward' am ausgepr├Ągtesten und bei
'Golden Fleece' am relativ geringsten; 'Discovery' ├╝bertrifft alle an Bl├╝hfreudigkeit, w├Ąhrend 'Golden FIeece' besonders sch├Ân geformte Bl├╝ten hat. Warum gerade
diese Kreuzung zu dem erw├╝nschten Resultat f├╝hrte, ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Wie schon erw├Ąhnt sind Cooperi Formen sehr oft f├╝r die
Weiterzucht benutzt, also auch schon vorher mit nopalxochia- und speciosus-bl├╝tigen Hybriden gekreuzt worden, ohne dass sich ein ├Ąhnliches Resultat eingestellt
h├Ątte. Es ist ja schon lange bekannt, dass sich das rote Pigment einer Nopalxochia, mehr noch eines Heliocereus speciosus, dominant weitervererbt. Bei den
hierzulande permanent unter Platzmangel leidenden Liebhabern mag aber vielleicht bis dato immer nur ein Teil der S├Ąmlinge einer solchen Allianz aufgezogen
worden sein, sodass der geringe Anteil an cooperi ├Ąhnlichen, vielleicht sogar etwas mehr nach Gelb tendierenden Nachkommen ganz einfach immer wieder verpasst
worden war. In Kalifornien, wo Phyllokakteen unter dem Einfluss des milden Klimas ganzj├Ąhrig in Gartenkultur gehalten werden, konnten Aussaaten ungleich gro├čz├╝giger
und damit auch mit viel mehr Aussicht auf Erfolg durchgef├╝hrt werden als bei uns.

Bild 4: ┬┤George French┬┤
Andererseits geh├Ârten Fort & O'Barr zu den prominentesten Z├╝chtern der Nach-Knebel-├ära und waren damit auch sicherlich Experten genug, um nicht ausschlie├člich auf Zufallsergebnisse angewiesen zu sein. Bei der Auswahl der Partner mag demnach das Kalk├╝l mitgespielt haben, dass bei der Kreuzung zweier Pflanzen mit ausgesprochen intensiv gef├Ąrbten ('Thorinne') und solchen mit schwach pigmentierten Bl├╝ten ('Madonna') bei gen├╝gend gro├čer Nachkommenschaft theoretisch auch einige Exemplare entstehen k├Ânnen, bei denen die Intensit├Ąt der Bl├╝tenfarbe des einen wie des anderen Elternteils in gesteigerter Form auftritt. Wie dem auch sei, ein wichtiger Anfang war gemacht, aber so gro├č der Fortschritt bei den Neuen auch war, sie weisen alle noch den Nachteil auf, bei im Knospenstadium zu warmer und sonniger Kultur innen fast wei├č zu bl├╝hen. Sie haben damit dieselben Eigenschaften wie fast alle Phyllos, n├Ąmlich je nach Kulturzustand und -art u. U. von Jahr zu Jahr unterschiedlich get├Ânte Bl├╝ten zu bringen. Um dies bei den "Gelben" zu vermeiden, tut man grunds├Ątzlich gut daran, die Pflanzen im Knospenstadium relativ k├╝hl um ca. 15-16┬░C herum zu belassen und nicht zu treiben, wenn man gut ausgef├Ąrbte Blumen bewundern will. Dar├╝ber hinaus ist immer noch ein deutlicher Unterschied zwischen inneren und ├Ąu├čeren Kronabschnitten zu sehen, der nicht dem Ideal entspricht. W├Ąhrend die ├Ąu├čeren Petalen ein sch├Ânes, kr├Ąftiges Gelb zeigen, sind die Inneren viel heller bis cremefarben, jedoch mit intensiverem Mittelstreif, sodass von Weitem betrachtet der Eindruck einer echt gelben Bl├╝te durchaus entsteht.

Bild 5: ┬┤Jennifer Ann┬┤
Die Neuz├╝chtungen haben damals viel Anklang gefunden und sind auch heute noch erh├Ąltlich. Die Blumen sind aber verbesserungsbed├╝rftig, und so nimmt es nicht wunder, dass seitdem immer wieder versucht wurde, die Qualit├Ąt der Farben zu steigern. Eine der bekannteren Sorten, die etliche Jahre sp├Ąter auf den Markt kam, ist die von P. Hutchison gez├╝chtete 'Clarence Wright', die aus der Kreuzung 'Reward' x 'Discovery' hervorgegangen ist und somit als direkte und logische Fortsetzung der Zuchtlinie anzusehen ist. Sie ├╝bertrifft ihre Eltern an Farbintensit├Ąt, ist aber immer noch ziemlich anf├Ąllig gegen├╝ber Farbabweichungen, ├╝ber deren Ursachen ich schon sprach. Etwas sp├Ąter erschienen auch die ersten gelben Sorten aus England, von denen die leider empfindliche 'London Sunshine', gez├╝chtet vom bekannten Autor des Phyllo-Buches "Fine Flowered Cacti", F. R. Mc. Quown, auch in Deutschland eine gewisse Popularit├Ąt erlangte. Einige Z├╝chter um den bekannten Sukkulenten Fachmann und Buchautor Clive Innes gingen andere Wege und griffen eine Idee von Johannes Nicolai wieder auf, der in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts versucht hatte, Echinopsis aurea (syn. Lobivia/Pseudolobivia aurea) einzukreuzen, was ihm angeblich auch gelungen war. Aus dieser Nachkommenschaft hat die Sorte 'Adelheid Nicolai' bis in die heutigen Tage ├╝berlebt, die aber wei├č und nicht gelb bl├╝ht. Seine 'G├╝ntheri' dagegen, die aus der Verbindung Nopalxochia phyllanthoides x Echinopsis aurea hervorgegangen war, soll schon einiges an Gelb aufzuweisen gehabt haben, ist aber in unseren Sammlungen schon l├Ąngst nicht mehr existent. Clive Innes (1990) berichtet nun in einem Artikel in "Epiphytes" von seinen, wie er meint, erfolgreichen Experimenten und denen seiner Freunde mit Echinopsis aurea, woraus seine gelbe Sorte 'Achievement' (Epiphyllum crenatum x Echinopsis aurea) als vielleicht Bekannteste hervorgegangen ist 4). Es f├Ąllt jedoch auf, dass seit Nicolais Zeiten Echinopsis aurea fast immer als Vaterpflanze fungiert hat, sodass die Nachkommen auch als Produkt von Irritationsbest├Ąubungen ├Ąhnlich wie bei einer sogenannten "Selbstung" und damit ohne direkte Beteiligung der o. a. Pflanze entstanden sein k├Ânnen. Angesichts der meist hybriden Natur der verwendeten Mutterpflanzen, die meines Erachtens auch bei den von Innes und Nicolai benutzten Epiphyllum crenatum bzw. Nopalxochia phyllanthoides nicht ganz auszuschlie├čen ist, kommt es bei der Nachkommenschaft dann zu einer ├Ąhnlich breit gef├Ącherten Aufspaltung der Eigenschaften wie ansonsten auch, was die Entstehung der gelben 'G├╝ntheri' und 'Achievement' auch erkl├Ąren k├Ânnte, zumal au├čer der vermeintlich von Echinopsis aurea geerbten Bl├╝tenfarbe keine weiteren typischen Eigenschaften des Vaters zu erkennen sind.

Bild 6: ┬┤Sonoma Sunshine┬┤
Seit Mitte der 70er Jahre erscheinen in immer k├╝rzeren Abst├Ąnden neue gelbbl├╝hende Phyllokakteen auf dem Markt, die fast ausschlie├člich ihren Ursprung
in Kalifornien haben. In diesem Zusammenhang sind besonders zwei Namen zu nennen, die die Phyllozucht der 70er und 80er Jahre ganz wesentlich mitbestimmt
haben: George French aus San Diego und der erst vor kurzem hochbetagt verstorbene Wressey Cocke aus Redondo Beach bei Los Angeles. Unter den H├Ąnden dieser
beiden M├Ąnner sind eine unglaubliche Zahl neuer Gartenformen entstanden, von denen manch eine sch├Âner als die andere ist. Nach meinen Sch├Ątzungen kann man davon
ausgehen, dass auch ├╝ber 90 % der heute erh├Ąltlichen "Gelben" von den beiden stammen oder unter Beteiligung ihrer Sorten herausgez├╝chtet wurden.
Man k├Ânnte annehmen, dass alle diese Pflanzen mehr oder weniger ├Ąhnlich untereinander sind, was aber durchaus nicht der Fall ist. Schon in der F├Ąrbung gibt es
Unterschiede, z. B. in Bezug auf den S├Ąttigungsgrad, also auf die Intensit├Ąt der in der Bl├╝te ausgebildeten Pigmentierung. Des Weiteren unterscheiden sich die
einzelnen Sorten in der Qualit├Ąt der gelben Farbe, die durch leichte Beimischung von Gr├╝n, Braun oder Orange eine ganz bestimmte T├Ânung annehmen kann. Die
Skala reicht hier von Zitronengelb ├╝ber Kanariengelb, Bronzegelb und Chromgelb bis hin zum strahlenden Goldgelb, variiert, wie schon erw├Ąhnt, durch verschiedenen
S├Ąttigungsstufen. Ein noch vielfaltigeres Bild ergibt sich, wenn man Bl├╝tengr├Â├čen und -formen mit einbezieht. Durch die ├╝berwiegende Abstammung von x
Seleniphyllum-Formen hat auch Selenicereus-"Blut" Eingang in die meisten Sorten gefunden, was sich positiv auf die Bl├╝tengr├Â├čen ausgewirkt hat, die in ihrer
Mehrheit gro├č bis sehr gro├č ausfallen. Die glocken-, becher- oder trichterf├Ârmigen Blumen erreichen im allgemeinen Durchmesser zwischen 18 und 25 cm, vereinzelt
sogar bis 30 cm, und viele duften dabei - sozusagen als Extrabonus - des Nachts sehr stark, ├Ąhnlich wie Lilien. Es gibt aber mittlerweile auch schon
sogenannte "Miniatur-Hybriden" mit viel kleineren, daf├╝r aber reichlicher und ├Âfter im Jahr erscheinenden, radf├Ârmig
sich ├Âffnenden, gelben Bl├╝ten, die ebenfalls einen starken Wohlgeruch, hier aber wegen ihrer
Disocactus (syn. Pseudorhipsalis) macranthus (Alex.) Kimn. &
Hutch.-Abstammung aufweisen 6).

Bild 7: ┬┤Madeline┬┤
Obgleich heute kein echter Mangel mehr an Pflanzen der hier besprochenen Art besteht, ist ihr Anteil an der Gesamtzahl der existierenden Phyllokakteen immer noch ziemlich gering. Es gibt sie ja auch noch nicht so allzu lange, und wenn man bedenkt, dass zwischen Aussaat und erstem, dabei wom├Âglich noch entt├Ąuschenden Erbl├╝hen Jahre vergehen, kann man sich unschwer einen Reim daraus machen. F├╝r jeden Z├╝chter ist es deswegen nach wie vor eine gro├če, aber auch eine viel Freude bringende Herausforderung, neue gelbe Hybriden zu erzielen, die in irgendeiner Hinsicht - sei es im S├Ąttigungsgrad oder in der Best├Ąndigkeit der Farbe oder aber in Bezug auf andere Kriterien wie W├╝chsigkeit, Bl├╝hfreudigkeit, Bl├╝tengr├Â├če, Bl├╝tenform oder Bl├╝tezeit - einen Fortschritt bringen. Eine derartige Neuz├╝chtung ist bei Liebhabern stets etwas Besonderes, und auf den j├Ąhrlich im Mai in Los Angeles, San Diego und San Franzisko stattfindenden Ausstellungen, bei denen nicht selten Hunderte von Phyllokakteen aller Kategorien in vollem Flor zu bewundern sind, werden neue "Gelbe" wie bisher mit spezieller Hinwendung und Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen. Die Pflege der gelbbl├╝tigen Gartenformen unterscheidet sich bis auf einen Punkt nicht von der anderer Phyllokakteen. Als Substrat verwenden wir dieselbe Erde wie bei Oster- bzw. Weihnachtskakteen oder wie bei Aporokakteen und deren Abk├Âmmlingen. 7) Gegossen wird mit m├Âglichst weichem, kalkarmen Wasser, denn Epiphyten sind gegen das Alkalisch-Werden des Bodens empfindlich. Notfalls muss jedes Jahr in frische, viel Torf enthaltende Erde umgetopft werden, um Wachstum und reiches Bl├╝hen aufrecht zu erhalten. Dabei kann man gleichzeitig ├╝berpr├╝fen, ob sich Wurzell├Ąuse eingenistet haben, den Einzigen ernst zu nehmenden, weil hartn├Ąckigen Sch├Ądlingen bei diesen Pflanzen, mit denen der Liebhaber seine liebe Not hat.

Bild 8: ┬┤Acapulco Sunset┬┤
Mit am wichtigsten bei der Kultur der Phyllos ist die Einhaltung einer mindestens 2-monatigen, besser viertelj├Ąhrlichen Ruhezeit von ca. November bis Ende Februar, in der sie an einem um 10┬░C k├╝hlen, jetzt auch m├Âglichst vollsonnigen Ort stehen m├Âchten. H├Âhere, von der Sonne verursachten Tagestemperaturen bei gleichzeitigem Absinken der W├Ąrmegrade des Nachts auch unter dem o. a. Wert sind dabei ├Ąu├čerst g├╝nstig und f├Ârdern den Bl├╝tenansatz, der sich je nach Sorte schon w├Ąhrend des Januar einstellen kann. Wir lassen die Pflanzen aber dennoch bis Anfang M├Ąrz ruhen und geben ihnen auch weiterhin nur gerade so viel Wasser, dass das Substrat schwach feucht bleibt, also nicht staubtrocken wird. Wetterkapriolen, wie sie in unseren Breiten ausgangs des Winters nur allzu oft auftreten, lassen sich auf diese Weise am besten ├╝berstehen. Etwaiger Knospenabfall braucht uns nicht zu beunruhigen, denn Phyllos bringen meistens sowieso nur so viele Bl├╝ten durch, wie sie "verkraften" k├Ânnen. Bei der Haltung, der gelben Sorten ist lediglich zu beachten, dass viele - aber nicht alle - allgemein etwas w├Ąrmere Temperaturen ben├Âtigen. Da Phyllos im Sommer gern an gesch├╝tzten, jetzt aber etwas absonnigen Stellen im Freien stehen m├Âchten, sollte man die "Gelben" als letzte aus- und als Erste im September wieder einr├Ąumen, um sie bei 12-14┬░C zu ├╝berwintern. Auf m├Âgliche Farbverf├Ąlschungen und was man dagegen unternehmen kann ist schon weiter oben hingewiesen worden.

Bild 9: ┬┤Marie Josephine┬┤
Ich habe in den letzten Jahren mit fast allen bekannteren und im Handel erh├Ąltlichen gelb bl├╝henden Sorten Erfahrungen sammeln k├Ânnen und m├Âchte zum
Schluss auf einige, die mir auf irgendeine Weise positiv oder negativ aufgefallen sind, noch gesondert eingehen.
Die empfindlichsten und am schlechtesten wachsenden Sorten waren 'Madeline' und 'Lemon Custard', wobei Letztere
zudem auch farblich nicht befriedigen kann. Beide sind nicht empfehlenswert.(siehe Anmerkung Webmaster)
Die Sorte mit den farbechtesten, dem Gelb eines Notocactus nicht nachstehenden
Blumen war 'Verano' (Bild 1), die aber unbedingt w├Ąrmer gehalten werden muss. ├ähnliches gilt f├╝r 'Marge Cocke'
(Bild 2). 'Olympic Gold' (Bild 3) macht ihrem Namen alle Ehre: "Olympisch" sind ihre robuste W├╝chsigkeit und
├╝berdurchschnittliche Bl├╝hfreudigkeit, die sich auch darin ├Ąu├čert, dass eine 2. Bl├╝tezeit im Sp├Ątherbst bis Winter ├╝blich ist. Der Flor ist zwar nur mittelgro├č,
daf├╝r aber in seinem best├Ąndig wiederkehrenden, leuchtenden Goldgelb ziemlich einmalig.
Als Pflanze mit den besten "Allround"-Eigenschaften w├╝rde ich 'George French' (Bild 4) bezeichnen, eine Hybride,
die unempfindlich gegen k├╝hlere Temperaturen ist, die leicht bl├╝ht, gutw├╝chsig ist und was den Gelbfaktor der Bl├╝te angeht einen guten Mittelplatz einnimmt.
Ahnlich einzusch├Ątzen ist 'Jennifer Ann' (Bild 5).
Die wohlgeformteste und dabei noch mit am st├Ąrksten duftende Blume hatte 'William Clark', auch wenn ihre Inneren, zu einem sch├Ânen Becher geformten Bl├╝tenbl├Ątter
"nur" cremefarben sind. Daf├╝r kontrastieren sie aber sehr attraktiv zu den elegant abstehenden, gelben bis bronzefarbenen ├Ąu├čeren Petalen.
Extrem gro├čblumige Formen sind 'Sonoma Sunshine' (Bild 6) und 'Marie Josephine', (Bild 9) deren Bl├╝tenkronen
30 cm im Durchmesser erreichen k├Ânnen.

Bild 10: ┬┤Dijonnaise┬┤
Nachtrag: 2009
Anmerkung: In der Zwischenzeit gibt es einige neue Erkenntnisse bez├╝glich der ÔÇÖCooperiÔÇÖ.
Fakt ist, dass die Herkunft dieser Pflanze unklar ist und nie eindeutig dokumentiert wurde. Es ist nur bekannt, dass ein Mr. Cooper sie zwischen 1870 und
1875 von einem Mr. Wilson Saunders aus Reigate (England) erhielt, dass sie daraufhin als ÔÇ×Phyllocactus cooperiÔÇť bezeichnet wurde und dass sie in der
Kew Garden-Sammlung
in den 90er Jahren als Hybride zwischen Epiphyllum crenatum und Selenicereus grandiflorus gef├╝hrt wurde, nachdem sie
von Regel (1884) als eine solche beschrieben worden war. Diese in der Folgezeit von vielen Kakteenexperten unterst├╝tzte Ansicht fu├čte auf bestimmten Merkmalen,
die eine Abstammung von den beiden genannten Eltern, vor allem auch von Selenicereus, als logisch erscheinen lassen, wie z.B. das dicht beschuppte und bedornte
Pericarpell, die runden, mit zahlreichen Borstendornen besetzten basalen Triebteile, aus denen dar├╝ber hinaus nicht selten die grandiflorus-├Ąhnlichen Bl├╝ten
erscheinen, etc. Diese Hybride und einige weitere von entsprechend vermuteter Abstammung (z.B. ÔÇÖWrayiÔÇÖ, ÔÇÖPfersdorffiiÔÇÖ, ÔÇÖTettauiÔÇÖ[Simon] u.a.) wurden innerhalb
der Phyllokakteen als ÔÇťCooperi-KlasseÔÇť zusammengefasst, f├╝r die das popul├Ąre Nothogenus x Seleniphyllum Rowley geschaffen wurde, das sp├Ąter aber
aus Priorit├Ątsgr├╝nden in x Epinicereus Wegener ge├Ąndert werden musste (Heath 1992).
Der erste Autor, der die hybride Abstammung der ÔÇÖCooperiÔÇÖ anzweifelte, war Myron Kimnach (1967), der sie als Wildform in die unmittelbare Verwandtschaft
von 'Epiphyllum crenatum var. kimnachii' stellte. Demgegen├╝ber stehen die Erkenntnisse von Innes und Passmore (1968), die 'Epiphyllum crenatum'
und Selenicereus grandiflorus erneut gekreuzt hatten und als Nachkommen typische Cooperi-Formen erhielten, so dass die alte Auffassung von
deren Hybriden Ursprung endg├╝ltig klar zu sein schien.
1997 publizierten Metz, Kimnach et al. in der
"Haseltonia"
eine Studie, in der durch aufw├Ąndige DNA-Untersuchungen best├Ątigt werden konnte, dass die ÔÇÖCooperiÔÇÖ sehr wohl eng verwandt ist mit
Epiphyllum crenatum bzw. dessen Variet├Ąt kimnachii. Die relativ geringf├╝gigen Unterschiede zu letzterer Pflanze (z.B. die andersartige Anordnung
der ├Ąu├čeren Bl├╝tenbl├Ątter auf dem Rezeptaculum) k├Ânnten eventuell erkl├Ąrt werden durch nat├╝rliche Kreuzung der beiden Unterarten Epiphyllum crenatum var.
crenatum und Epiphyllum crenatum var. kimnachii am gemeinsamen Wildstandort.
Damit stehen nach wie vor zwei kontr├Ąre Auffassungen ├╝ber die Abstammung der ÔÇÖCooperiÔÇÖ einander gegen├╝ber, die beide durch gute Argumente untermauert werden
k├Ânnen. Nach meiner Meinung k├Ânnte es sein, dass beide ÔÇ×LagerÔÇť recht haben, dass n├Ąmlich durch Kreuzung von Epiphyllum crenatum mit Selenicereus grandiflorus
der sehr seltene Fall eingetreten sein k├Ânnte, dass die aus dieser Allianz entstandenen Hybriden sich der erstgenannten botanischen Art oder deren Unterart
so sehr zum Verwechseln ├Ąhnelten, dass man hier von der Entstehung einer sog. ÔÇ×synthetischen ArtÔÇť sprechen k├Ânnte. Die ÔÇÖCooperiÔÇÖ (und zwar nur diese Pflanze)
in unseren Sammlungen k├Ânnte demnach - ohne dass wir es im Einzelfall wissen - entweder eine Wildpflanze aus der engsten Verwandtschaft von Epiphyllum crenatum
oder aber eine Hybride zwischen dieser Pflanze und unserer ÔÇ×K├Ânigin der NachtÔÇť sein.

Bild 11: ┬┤Canary Princess┬┤
- Bei andern Familien weit verbreitete rote, blaue und violette Pflanzenfarbstoffe.
- Das reinste Blau innerhalb der Cactaceae tritt bei Disocactus (syn. Wittia) amazonicus (Schum.)~ Hunt auf, kann aber von Klon zu Klon recht unterschiedlich in der Intensit├Ąt sein.
- Nicht zu verwechseln mit der speciosus-bl├╝tigen Haage-Sorte gleichen Namens, die karminrot bl├╝ht.
- Siehe Farbfoto in: Innes/Glass: Cacti, S. 88 (New York 1991)
- Beide Arten sind "alte Bekannte" in europ├Ąischen Sammlungen und kommen hier h├Ąufig nur noch in verbastardierter Form vor, ├Ąhnlich wie wir es schon von einigen Echinopsis- oder Selenicereus-Species her kennen.
- Siehe hierzu auch meinen Artikel ├╝ber Miniatur- Phyllokakteen mit Abbildungen in Kaktusbl├╝te 7, April 1990
- Siehe hierzu auch meine Artikel in Kaktusbl├╝te 5, 6 u.8.
Bemerkung Webmaster K. Rippe
Diese Einsch├Ątzung kann ich aus meiner langj├Ąhrigen Erfahrung mit der ┬┤Madeline┬┤ nicht best├Ątigen. Das deckt sich mit Kulturerfahrungen anderer Liebhaber die die Sorte ┬┤Madeline┬┤ ├╝ber viele Jahre problemlos kultiviert haben. Meines Erachtens ist diese George French Hybride eine der Besten gelben Phyllosorten ├╝berhaupt. Da George French diese Sorte nach seiner Frau Madeline benannt hat, kann man ebenfalls davon ausgehen das es sich um eine sehr gute Sorte handelt. Bei mir hat die Madeline in einer Vielzahl von Jahren, unter vollkommen unterschiedlichen Kulturbedingungen in Nordeuropa und in Andalusien, beste Ergebnisse gebracht. Meine Empfehlung, eine sehr empfehlenswerte gelbe Phyllo-Hybride.
┬┤Verano┬┤:
Bei mir hat die Sorte Verano in vielen Jahren der Kultur keinerlei Probleme mit niedrigen Temperaturen gezeigt. Mehrere Verano Pflanzen standen an unterschiedlichen Pl├Ątzen im kalten Gew├Ąchshaus mit allen anderen Phyllos zusammen ohne irgend welche Probleme durch zu kalte Aufstellung zu zeigen. Eine gesonderte Behandlung und ein spezieller w├Ąrmerer Platz w├Ąre unter meinen Kulturbedingungen auch nicht m├Âglich. Der grosse Vorteil dieser Hybride liegt meines Erachtens in den sehr sch├Ânen dunkel gelben und kompakten Bl├╝ten. Dazu werden die Pflanzen bei weitem nicht so gross und sparrig wie andere gelbe Phyllo-Sorten.
Back
Der Artikel '├ťber gelbbl├╝hende Phyllokakteen', wurde 1994 in der 'Kaktusbl├╝te' der Wiesbadener Kakteenfreunde ver├Âffentlicht. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Redaktion der Kaktusbl├╝te.