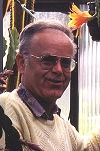Seit etwa 10 bis 15 Jahren erfreuen sich Miniatur-Phyllokakteen, meist nur "Minihybriden" oder kurz "Minis" genannt, bei den Liebhabern epiphytischer Kakteen steigender Beliebtheit. Im Gegensatz zu ihren "gro├čen Br├╝dern" zeichnen sich diese Pflanzen durch kleineren, z.T. auch sehr deutlich kleineren Wuchs aus, und ihre Bl├╝ten erreichen nur Durchmesser, die 10 bis 12 cm im allgemeinen nicht ├╝berschreiten, in einigen F├Ąllen sogar kaum 5 cm erreichen. Besonders, was diesen letzten Punkt anbelangt, markiert die Z├╝chtung dieser Pflanzen eine klare Abkehr von herk├Âmmlichen Idealen, indem sie n├Ąmlich bewusst auf die Erzielung immer gr├Â├čerer Bl├╝ten bei Phyllos verzichtet, mit der n├Ąmlich zwangsl├Ąufig auch eine Herabsetzung der Bl├╝tenzahl einhergeht. So bewunderungsw├╝rdig die Erfolge auf diesem Gebiet auch waren und sind - die "magische" Grenze von Bl├╝ten mit 30 cm im Durchmesser ist vereinzelt erreicht, sogar schon ├╝berschritten worden und Blumen um die 25 cm gibt es geradezu massenhaft - es kann uns nicht verwundern, dass solche Exemplare, vor allem, wenn sie noch jung sind, kaum mehr als jeweils nur ein paar dieser Riesenbl├╝ten auszubilden verm├Âgen, um sich danach viele Monate auf den n├Ąchsten "Kraftakt" dieser Art vorzubereiten. Dies ist einer der "wunden Punkte" unserer Phyllos, der ihnen eine gr├Â├čere Beliebtheit verwehrt, dass sie n├Ąmlich au├čer in ihrer kurzen, spektakul├Ąren Bl├╝tezeit im Fr├╝hjahr, wo ihre einmalig sch├Ânen Blumen viel Bewunderung und Anerkennung finden, zu lange in eine Art "Dornr├Âschenschlaf" verfallen und "nutzlos" umherstehen m├╝ssen, als dass man sich ernsthaft mit ihnen besch├Ąftigen m├Âchte. Genau in dem Punkt k├Ânnten Miniatur-Hybriden als neue Rasse eine Wende bringen, denn sie sind in der Lage, mit speziell diesem Nachteil, aber auch mit einigen weiteren vermeintlichen oder realen Unzul├Ąnglichkeiten aufzur├Ąumen, die man den "Gro├čen" gern nachsagt:
1. Sie bringen zwar nur kleine, oft sogar nur miniaturhafte Bl├╝ten, aber diese erscheinen in so gro├čer F├╝lle, dass man aus dem Staunen nicht
herauskommt. Nicht selten erwachsen aus jeder einzelnen Areole eines ausgereiften Triebes Knospen, die, gute Kultur vorausgesetzt, auch durchgebracht werden
und sich voll entwickeln.
2. Da diese Bl├╝ten weniger an die Substanz der Pflanzen gehen, k├Ânnen diese schon viel fr├╝her bl├╝hreif werden.Schon vor Jahrzehnten versuchten Haage und Knebel
mit Erfolg, dieses Zuchtziel zu verwirklichen, aber bei ihren sogenannten "jungbl├╝henden" Kreationen handelte es sich um ansonsten "normal" wachsende Phyllos
mit normal gro├čen Bl├╝ten, die in normaler Anzahl erschienen. Mit der fr├╝heren Bl├╝hreife der Minis h├Ąngt auch die erfreuliche Tatsache zusammen, dass Stecklinge
in aller Regel schon im folgenden Jahr Bl├╝ten bringen k├Ânnen, ein Extrabonus, der gern akzeptiert wird, da dies bei den herk├Âmmlichen Gartenformen
verst├Ąndlicherweise mindestens ein Jahr l├Ąnger dauert.
3. Fast alle Miniatur-Hybriden bl├╝hen mehrfach im Jahr, also nicht nur zur Hauptbl├╝tezeit im Fr├╝hjahr, sondern auch zu andern Zeiten, insbesondere und gerade
auch im Herbst und Winter, wo ansonsten kaum etwas bl├╝ht. Wenn man sich auskennt und sich aus
dem mittlerweile gut sortierten Angebot einen Grundstock geeigneter Pflanzen ausw├Ąhlt, ist es m├Âglich, in allen Monaten
des Jahres Bl├╝ten zu sehen, ein Vorteil, der nicht nur
gegen├╝ber den "gro├čen Br├╝dern" besonders zu Buche schl├Ągt und
nicht hoch genug zu w├╝rdigen ist. Die Dauer des Flors ist dabei
vergleichbar mit der bei andern Phyllos, aber unter dem Einfluss
k├╝hlerer Temperaturen im Herbst und Winter kann die Haltbarkeit
der Einzelbl├╝ten bedeutend l├Ąnger sein als die ├╝blichen 2 bis 3
Tage, die w├Ąhrend der w├Ąrmeren Jahreszeiten als Durchschnitt
gelten k├Ânnen.

Abb. 1 ┬┤Cheerfulness┬┤

Abb. 2 ┬┤Petey Kelly┬┤
4. Einige Mini-Hybriden zeigen ein bei Kakteen sehr seltenes
Ph├Ąnomen. Sie sind in der Lage, aus einer einzigen Areole
mehrere Bl├╝ten entweder zugleich oder nach und nach zu
entwickeln. Normalerweise k├Ânnen sich aus Areolen bei Phyllos
und andern Kakteen nur ein einziges Mal Bl├╝ten oder
Seitensprosse bilden, danach sind sie "tot". Triebe, die
solcherma├čen schon oft gebl├╝ht haben, werden nach einiger Zeit
"wertlos" und m├╝ssen, wie allgemein bekannt ist, dann
zur├╝ckgeschnitten werden, damit sich die nachwachsenden
Jungsprosse besser entwickeln und somit auch besser bl├╝hen
k├Ânnen. Bei den Minis mit oben charakterisierten, sogenannten
"proliferierenden Areolen" ist ein R├╝ckschnitt zun├Ąchst nicht
zu empfehlen, da sie ja weiterhin bl├╝hen k├Ânnen, was als
zus├Ątzlicher Pluspunkt zu werten ist. Sp├Ątere Bl├╝ten aus
solchen Sprossknospen erkennt man ├╝brigens daran, dass sie an
einer etwas anderen Stelle derselben Areole und infolgedessen
in einer merkw├╝rdigen Winkelstellung zu ihr erwachsen und dann
den Eindruck vermitteln, unnat├╝rlich "schief" zu den Sprossen
zu stehen, was der Sch├Ânheit aber keinen Abbruch tut.
5. Als letzter wichtiger Punkt ist hervorzuheben, dass etliche
Mini-Sorten in ihren Dimensionen eher bescheiden bleiben, auch
wenn man fairerweise zugeben muss, dass ein Teil dieses "Gewinns"
dadurch wieder verloren geht, dass fast alle wegen ihrer
h├Ąngenden Wuchsform als Ampelpflanzen gehalten werden m├╝ssen.
Andererseits findet sich f├╝r Ampeln oft noch ein Pl├Ątzchen, wo
andere, aufrecht wachsende Exemplare nicht untergebracht werden
k├Ânnten, so dass man insgesamt doch sagen kann, dass sich der
kompaktere Gesamthabitus dieser Pflanzen als erfreuliches
Faktum herausstellt.
Bei so vielen Vorteilen w├Ąre es nur eine Frage der Zeit, wann diese neue Rasse unsere herk├Âmmlichen Phyllos verdr├Ąngen w├╝rde. Dem ist jedoch nicht so, denn die "Minis" haben gegen├╝ber den "Maxis" auch ein paar Mankos, die nicht unerw├Ąhnt bleiben sollen:

Abb. 3 ┬┤Lilliput┬┤

Abb. 4 ┬┤Delicate Jewels┬┤
1. Unter den Phyllos gibt es mittlerweile ├╝ber 6.000 registrierte Sorten in allen m├Âglichen Bl├╝tengr├Â├čen, -formen und -farben, au├čer in reinem Gr├╝n und Blau. Die Auswahl ist schier unermesslich! Diese F├╝lle an vor allem verschiedenfarbigen Kreuzungen ist bei unsern Minis aber noch lange nicht erreicht. Es gibt zwar inzwischen auch schon mehrfarbige und sogar gute, gelbbl├╝hende Formen, aber die meisten bringen etwas einseitig nur Blumen im rot-rosa-orangenen Farbbereich geringeren S├Ąttigungsgrades. Anders als bei den Maxis ergibt sich die Attraktivit├Ąt dieser Pflanzen deshalb weniger durch die Wirkung ihrer kleinen, oft relativ blassen Einzelbl├╝ten, als durch deren in verschwenderischer F├╝lle erscheinenden Gesamtzahl, die den Betrachter in Entz├╝cken versetzt.
2. Viele Mini-Hybriden sind empfindlicher gegen k├╝hlere
Temperaturen als ihre gr├Â├čeren Br├╝der, worauf ich sp├Ąter noch
im einzelnen eingehen werde. Sie sind nicht schwer zu
kultivieren, aber bestimmte Formen brauchen Mindesttemperaturen
von 12, besser 14 Grad Celsius, was ihre "Tauglichkeit" in
manchen Liebhabersammlungen aber einschr├Ąnkt.
3. Trotz erzielter Anfangserfolge wachsen viele Hybriden noch
nicht kompakt genug, um als echte "Miniaturen" gelten zu
k├Ânnen. In der Zucht ist mehr als bisher darauf zu achten, auch
im Habitus kleine Pflanzen zu erzielen, denn - und davon bin
ich fest ├╝berzeugt - erst dann und im Zusammenhang mit den
o.a. Vorteilen wird ihnen eine noch gr├Â├čere Popularit├Ąt zuteil
werden.

Abb. 5 ┬┤Apricot Sensation┬┤

Abb. 6 ┬┤Equator┬┤
Wie war es nun m├Âglich, die bereits geschilderten Anfangserfolge zu erzielen? Zun├Ąchst, so ganz neu sind diese Phyllos keineswegs! Schon Knebel hat mit Sorten wie 'Harald Knebel', 'Fr├╝hling', 'Erich Matthes', 'Frau Maria R├╝hl', u.a. den Weg andeutungsweise beschritten, der heute so erfolgreich zu werden verspricht. Theresa Monmonnier, eine der bekanntesten amerikanischen Z├╝chterinnen der fr├╝hen Nachkriegsjahre, verwendete sehr erfolgreich
Nopalxochia phyllanthoides (De Candolle) Br.& R. 1) - als botanische Ausgangsart selbst schon ein Mini mit bemerkenswerten Eigenschaften - sowie Disocactus (syn. Chiapasia) nelsonii (Br.& R.) Lindinger, um eine neue klein-, aber vielbl├╝tige Rasse zu erzielen, die damals aber noch nicht "Miniatur-Hybriden" genannt wurde. Einige Gartenformen von damals sind heute aber unter dieser neuen Wortsch├Âpfung immer noch zu haben, was zeigt, wie weit diese inzwischen l├Ąngst verstorbene Z├╝chterin ihrer Zeit voraus war.
So richtig popul├Ąr wurde die neue "Mini-Welle" aber erst vor ca. 15 Jahren, als man daran ging, planvoller zu z├╝chten. 2) Als Ausgangsmaterial verwendete man, wie bisher schon, Nopalxochia phyllanthoides, vornehmlich ihre minimal differenzierte Selektionsform 'Deutsche Kaiserin' 3) und Disocactus nelsonii. Hinzu kamen als ungemein wichtige Elemente dieser neuen Rasse Pseudorhipsalis macranthus Alexander (vielfach auch bei Disocactus Lindley gef├╝hrt) sowie
Disocactus biformis (Lindley)
und Disocactus eichlamii (Weingart) Br.& R.,
die deshalb so bedeutend sind, weil sie kleinw├╝chsig sind und reichlich und mehrfach im Jahr ihre kleinen Bl├╝ten bringen, was sich auch bei den neuen Hybriden bemerkbar machte. Zur Erweiterung der Farbpalette wurden vereinzelt botanische Arten der Gattungen Heliocereus (Berger) Br.& R., Aporocactus Lemaire und Epiphyllum Haworth sowie Phyllos eingekreuzt, wodurch diese neuen Kultivare nicht nur abwechselungsreicher bl├╝hten, sondern auch robuster wurden. Der Duft mancher Blumen ist in erster Linie Pseudorhipsalis macranthus zuzuschreiben, mag hier und da aber auch auf die neue Verwandtschaft mit den "Gro├čen" zur├╝ckzuf├╝hren sein, unter denen ja eine ganze Reihe duftender Sorten zu finden sind.
Alles in allem stellen Miniatur-Hybriden eine ideale Erg├Ąnzung zu letzteren dar, die in keiner Sammlung fehlen sollten. Die Entwicklung
steht erst an ihren Anf├Ąngen! Durch weiteres planm├Ą├čiges Kreuzen der vorhandenen Sorten untereinander sollte es m├Âglich sein, noch kleinere Gartenformen zu erzielen mit noch farbenfreudigeren Bl├╝ten, die noch mehr als bisher schon auch au├čerhalb der fr├╝hj├Ąhrlichen Hauptbl├╝tezeit erscheinen sollten. Nach langj├Ąhrigen Erfahrungen, die ich mit diesen Pflanzen sammeln konnte, m├Âchte ich diese in 5 Gruppen einteilen, in denen der Einfluss jeweils einer der Ausgangsarten meist so stark dominiert, dass sie sich in ganz augenf├Ąlliger Weise voneinander unterscheiden.
Die erste Gruppe wird gebildet von Nopalxochia phyllanthoides und ihr nahestehenden Sorten, die in der Bl├╝tenform stark an die 'Deutsche Kaiserin' erinnern, entfernt Narzissenbl├╝ten ├Ąhneln, und deren Blumen in der Regel um die 10 cm oder etwas mehr im Durchmesser gro├č sind. Die Bl├╝hwilligkeit der meist als Samenlieferant ("Mutter") verwendeten Ausgangsart ist schon sprichw├Ârtlich, und dies wie auch die Tendenz, im Herbst noch einmal zu bl├╝hen, haben sich sehr oft auf die Nachkommenschaft ausgewirkt, in manchen F├Ąllen aber auch deren Blattfleckenkrankheit, gegen die es kein Mittel gibt, die aber erst ├Ąltere Triebe bef├Ąllt, besonders, wenn die Pflanzen im Sommer ├╝ber l├Ąngere Zeit N├Ąsse und K├╝hle ertragen m├╝ssen. Kann man ihnen einen ├╝berdachten, regengesch├╝tzten Platz im Freien bieten, h├Ąlt sich diese Krankheit in ertr├Ąglichen Grenzen, die ansonsten die Pflanzen kaum beeintr├Ąchtigt, sondern eher ein ├Ąsthetisches Problem darstellt, das durch sp├Ąteren Verj├╝ngungsr├╝ckschnitt weiterhin gemildert werden kann. Die meisten Mitglieder dieser Gruppe wachsen als Ampelpflanzen leider etwas sparrig, ben├Âtigen also mehr Platz als andere Minis, sind daf├╝r aber in aller Regel robuster und k├Ânnen im Winter bei 10 Grad und darunter gehalten werden. Die Angeh├Ârigen dieser Abteilung sind ├╝berwiegend Monmonnier-Sch├Âpfungen und damit bereits ├Ąlteren Datums, denn Pseudorhipsalis- und Disocactus-Eigenschaften stehen bei Neuz├╝chtungen momentan eindeutig h├Âher im Kurs (siehe unten). In diese Gruppe geh├Âren Hybriden wie 'Bambi', 'Rosetta', 'Gay Senorita', 'Dragonet', 'Infanta', 'Fairy Bell', 'Grand Duchess', 'Mormor', 'Pink Parasol', 'Ursula Le Guin', u.v.a.

Abb. 7 ┬┤Deutsche Kaiserin┬┤
In die zweite Gruppe geh├Âren die Disocactus (Chiapasia) nelsonii
-Hybriden.
Die Bl├╝ten sind wie bei der Art glockenf├Ârmig und ├Ąhneln Lilien-Blumen. Sie sind meist kleiner als bei den phyllanthoides-Abk├Âmmlingen, und auch die Triebe sind etwas d├╝nner, so dass diese Blendlinge kompaktere Ampelpflanzen abgeben und dem Ideal der Kleinw├╝chsigkeit etwas n├Ąher kommen. Die Gartenformen sind im Vergleich zur primadonnahaften Ausgangsart viel robuster und ausreichend unempfindlich gegen k├╝hlere Temperaturen, wenn sie auch nicht ganz die H├Ąrte der ersten Gruppe erreichen. Sie bl├╝hen gut, viele auch im Herbst/Winter, erreichen aber meist nicht ganz die sagenhafte Bl├╝tenf├╝lle der oben genannten Kategorie. Erw├Ąhnenswert ist aber, dass unter diesen Pflanzen bereits solche mit proliferierenden Areolen vorzufinden sind, was f├╝r sie spricht. Hierher geh├Âren die ├Ąlteren Monmonnier-Kreationen 'Chiapora Nayada', 'Chiapora Pinky', 'Marionette', 'Angels Trumpet', u.a., aber auch Knebels leider sehr empfindliche 'Fr├╝hling' sowie die neueren Sorten 'Elberta Kipp' (eine viel h├Ąrtere Weiterentwicklung der vorigen) 'Fern LaBorde', 'Diana Inglese', 'Cheerfulness' (mit dem dunkelsten, mir bekannten Rot der Bl├╝ten),'Petite Pink', 'Apricot Sensation', 'Raspberry Ice', 'Sweet Kisses', u.a.
Bei der dritten Gruppe handelt es sich um Disocactus biformis und Disocactus eichlamii-Hybriden, die sich nur wenig voneinander unterscheiden. Die Disocactus biformis-Abk├Âmmlinge neigen zu Bl├╝ten mit ausgepr├Ągter, regelm├Ą├čiger Glockenform mit weit zur├╝ck geschlagenen Petalen, w├Ąhrend der Flor der Disocactus eichlamii-Blendlinge sich vielfach etwas geringer ├Âffnet und dabei weniger gleich-
m├Ą├čig glockig ist. In dieser Abteilung finden wir die kleinsten Pflanzen mit dem kleinsten, fast filigranartigen Flor, der sich oft wie miniaturhafte Ausgaben der obigen nelsonii-Hybriden ausnehmen und ├╝beraus reichlich zu praktisch allen Jahreszeiten erscheinen k├Ânnen. Die genannten Stammarten sind wenig sukkulent und w├Ąrmebed├╝rftig, was auch f├╝r die meisten - wennauch nicht f├╝r alle - Kreuzungen hier gilt. Sie sind leicht zu kultivieren, wenn man ihnen m├Âglichst keine Temperaturen unter 12 - 14 Grad zumutet und sie regelm├Ą├čig, aber mit Bedacht und in Ma├čen w├Ąssert, da sie bei allzu langen Gie├čpausen fast wie andere Gr├╝npflanzen vertrocknen k├Ânnen, andererseits aber auch gegen├╝ber allzu gro├čer N├Ąsse des Substrats empfindlicher als andere mit Wurzelverlust reagieren. Diese Hybriden sind wie die folgenden Pseudorhipsalis (Disocactus) macranthus-Sorten ideale Zimmerpflanzen, die sich, ├╝ber dem Fensterbrett h├Ąngend, unter Weihnachtssternen, Monsteras, Hibiscus- und Ficus-Arten, Callas, Bromeliengew├Ąchsen, Zimmerorchideen, Weihnachts- und Osterkakteen usw. sehr wohl f├╝hlen und auch ├Ąhnliche Lichtanpr├╝che stellen, indem sie m├Âglichst helle Standorte lieben, aber keine direkte Sonne vertragen, au├čer in den Wintermonaten. Sehr viele der im Folgenden angef├╝hrten Kultivare sind Sch├Âpfungen eines des profiliertesten und produktivsten Z├╝chters unserer Tage, dem wir Hunderte von herrlichen Phyllo-Hybriden aller m├Âglichen Kategorien verdanken: Wressey Cocke aus Redondo Beach, Kalifornien! Beispiele, die hierher geh├Âren, sind: 'Delicate Jewels', 'Pete's Snowflake', 'Red Elf', 'Christmas Red', 'Nathalia', 'Sugar Baby', 'Gold Coin', 'Leprechaun', 'Sweet Kisses', 'M├Ąrzsonne' 4), 'Eve`(die kleinste Mini-Hybride mit den kleinsten Blumen, die ich kenne) u.v.a.

Abb. 8 ┬┤Gold Coin┬┤

Abb. 9 ┬┤Oriental Spring┬┤
In die vierte Gruppe lassen sich alle Pflanzen einordnen, die von Pseudorhipsalis (Disocactus) macranthus abstammen, einer kleinbl├╝tigen Art 4) mit Kronen von 4 - 6 cm im Durchmesser und wenigen, cremfarbenen bis gelblichen Petalen, die sich nicht ganz einheitlich, jedoch weit ├Âffnen und dadurch ein gewisses "spinnenhaftes" Aussehen haben. Die Bl├╝ten erscheinen in Massen und duften stark; die Pflanzen werden nicht allzu gro├č und sind gut in H├Ąngek├Ârbchen zu halten. Sie und ihre Hybriden verlangen ebenfalls mehr W├Ąrme und k├Ânnen genauso gehalten werden, wie die Kultivare der vorigen Gruppe, denen sie manchmal auch im Gesamthabitus ├Ąhneln, obgleich sie im Durchschnitt etwas gr├Â├čere Dimensionen erreichen. Die Ma├če der Bl├╝ten sind uneinheitlich und reichen von 5 bis 12 cm im Durchmesser, wobei aber ihre typisch flatterige, z.T. fast radf├Ârmige Gestalt immer erkennbar bleibt. Unter den Repr├Ąsentanten dieser Gruppe, von denen wiederum eine ganze Anzahl aus der Hand Wressey Cockes stammen, gibt es besonders viele Winterbl├╝her, und der Duft, der viele auszeichnet, wird als willkommene Beigabe empfunden. Auch unter den im folgenden aufgelisteten Exemplaren kommen viele mit proliferierenden Areolen vor: 'Tiny Flame', 'George's Favourite', 'Solis Glow', 'Sand Pebbles', 'Wild Honey', 'Naranja', 'Lollipop', 'Confetti', 'Fr├╝hlingsanfang' 4), 'Petey Kelly', 'Fred Boutin' (die letzten beiden bl├╝hen in einem bei Minis noch seltenen Gelb), u.v.a.
Die f├╝nfte und letzte Gruppe schlie├člich ist uneinheitlicher. Sie umfasst alle solche Pflanzen, die sich nicht in eine der obigen Kategorien einordnen lassen. Es handelt sich hier entweder um Hybriden, die durch das Einkreuzen mit gro├čen Phyllos deren Bl├╝tenform und -farben geerbt haben bei ansonsten noch "minihaftem" Gesamteindruck, oder um Blendlinge, bei denen eine pr├Ągnante Dominanz einer der obigen botanischen Ausgangsarten nicht mehr feststellbar ist bzw. nur noch erahnt werden kann. Letztere sind meist Kreuzungsprodukte zwischen Eltern, die verschiedenen Gruppen im obigen Sinn angeh├Âren und deren charakteristischen Merkmale sich in den Filialgenerationen allm├Ąhlich
"verwischt" haben. Gem├Ą├č ihrer heterogenen Herkunft gibt es in dieser Gruppe keine gemeinsamen Merkmale mehr; die Pflanzen sind habituell nicht einheitlich und bei den Bl├╝ten gibt es deutliche Unterschiede in Gr├Â├če, Form und Farbe, wobei letztere am intensivsten von allen Minis bei denen ist, die von den "Gro├čen" abstammen.
Diese Kultivare sind zudem auch ziemlich robust, daf├╝r aber nicht die kompaktesten, und manche von ihnen kann man ebenso gut aufrecht wachsend an St├Âcken wie als Ampelpflanzen ziehen. Zu dieser Gruppe z├Ąhlen 'Destiny', 'Shinto', 'Snowflake', 'Lady Luck', 'Sugar Plum Fairy', 'Lilliput', 'Orange Bouquet', 'Kind of Special', 'Piland's Pride', 'Wedding Bells', 'Equator' (nicht zu verwechseln mit der Haage-Z├╝chtung 'Aequator'), wobei noch zu erw├Ąhnen ist, dass diese Gruppe durch weitere Hybridisierung untereinander zuk├╝nftig wohl noch an Umfang zunehmen wird.
Falls Sie, lieber Leser, Interesse an diesen Gartenformen gefunden haben, wenden Sie sich bitte an die weiter unten angef├╝hrten Firmen, die normalerweise ├╝ber ein gr├Â├čeres Angebot verf├╝gen. Patentrezepte ├╝ber die praktische Haltung zu geben, ist hier nicht m├Âglich, da die Pflanzen insgesamt zu verschieden sind, und sich die individuellen Gegebenheiten bei den einzelnen Liebhabern auch zu unterschiedlich gestalten. Sie sind aber f├╝r gew├Âhnlich nicht schwer zu kultivieren, wenn man bedenkt, dass alle diese Gesch├Âpfe Epiphyten sind und wie solche behandelt werden m├╝ssen. Durch den t├Ąglichen Umgang mit ihnen lernt man am besten selbst, welche Anspr├╝che und Bed├╝rfnisse gestellt werden, die ganz ├Ąhnlich sind wie bei Weihnachts- und Osterkakteen, ├╝ber die ich in den letzten beiden Ausgaben von "Kaktusbl├╝te" ausf├╝hrlich berichtete. Wenn man nicht gerade zu den Sammlern geh├Ârt, deren Leidenschaft vornehmlich stachelstarrenderen Objekten gewidmet ist, wird man sehr viel Freude an Miniatur-Hybriden finden und deren Bl├╝tenf├╝lle zu verschiedenen Jahreszeiten ganz besonders zu sch├Ątzen wissen.

Abb. 10 ┬┤Naranja┬┤
Fu├čnoten
1) In einer kritisch ├╝berarbeiteten Liste von anerkannten
Gattungen innerhalb der Cactaceae, die von einer IOS-
Arbeitsgruppe 1984/85 erstellt wurde, werden die Gattungen
Heliocereus (Berger)Br.& R., Nopalxochia Br.& R. und Disocactus
Lindley (ohne Pseudorhipsalis Br.& R. und Wittia K.Schumann)
unter dem nomenklatorisch ├Ąltesten Namen Disocactus Lindley
1845 vereint. Barthlott (1988) geht noch einen Schritt weiter,
indem er auch noch Aporocactus Lemaire in die neue
Sammelgattung einbezieht.
2) Die Z├╝chtung von Mini-Hybriden wie auch von Phyllos allgemein
geschieht heute fast ausschlie├člich in S├╝dkalifornien, wo vor
allem auf Grund des dort herrschenden g├╝nstigen Klimas
ganzj├Ąhrig Gartenkultur ohne Unterbringungsprobleme m├Âglich
ist.
3) Um die Herkunft der 'Deutschen Kaiserin' wurde bis in die
heutigen Tage viel herumger├Ątselt. Manche meinen, sie sei eine
Hybride der botanischen Art Nopalxochia phyllanthoides, andere
gehen davon aus, dass es sich bei ihr lediglich um eine
Selektion obiger Species handele, die nur etwas gr├Â├čere Bl├╝ten
bringe. Ohne auf diese Frage hier n├Ąher eingehen zu k├Ânnen,
m├Âchte ich mich hier entschieden gegen die Hybridentheorie
aussprechen, was gerade durch Kreuzungsversuche mit dieser
Pflanze erh├Ąrtet werden kann.
4) Alfred Lau fand vor Jahren eine interessante Variante dieser
Pflanze mit bl├Ąulich bereiften Trieben und erheblich gr├Â├čeren,
ebenfalls duftenden Bl├╝ten, die bis vor kurzem nur unter der
Lau-Nr.1263 bekannt war, inzwischen aber von Ernst Ewald,
Hamburg, als Disocactus macranthus var. glaucocladus in
"Epiphytes" 13 (52):106 -108, 1989 beschrieben wurde. Diese
Pflanze benutzte Kurt Petersen, Osterholz-Scharmbeck, f├╝r viele
seiner Kreuzungen, u.a. auch mit Disocactus nelsonii
(= 'Fr├╝hlingsanfang') und mit Nopalxochia phyllanthoides
(= 'M├Ąrzsonne'). W├Ąhrend erstere Hybride eindeutig in die Gruppe
vier geh├Ârt, ├Ąhneln die Bl├╝ten der 'M├Ąrzsonne' eher denen der
Disocactus biformis/eichlamii - Abk├Âmmlinge (Gruppe drei),
obgleich beide Arten an der Entstehung dieser Gartenform g├Ąnzlich
unbeteiligt waren.
Der Artikel 'Miniatur-Phyllokakteen', wurde 1990 in der 'Kaktusbl├╝te' der Wiesbadener Kakteenfreunde ver├Âffentlicht. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Redaktion der Kaktusbl├╝te.