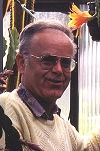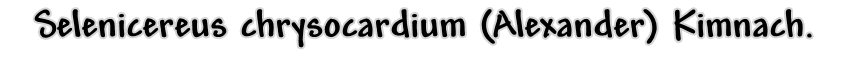Als Tom MacDougall im Jahre 1951 einen Trieb dieser Pflanze in das Büro von 'E.J. Alexander' brachte, glaubte man auf dem ersten Blick, einen etwas ungewöhnlichen Farn vor sich zu haben. Bei näherer Untersuchung stellte sich dann aber bald heraus, dass es sich hierbei um einen Kaktus aus der näheren Verwandtschaft von Epiphyllum Haworth handeln dürfte. Zwei Jahre später hatte die Pflanze im November fünf Knospen angesetzt, von denen vier abgestoßen wurden, noch ehe sie sich zu nennenswerter Größe hatten entwickeln können. Die letzte verbliebene allerdings versetzte das Team um Alexander, damals Leiter des Botanischen Gartens in New York, in große Aufregung, denn es stellte sich alsbald heraus, dass sie sich um die Weihnachtszeit herum anschicken würde, zum ersten Mal in der Kultur zu blühen. Sie wurde nun ständig unter genaue Beobachtung gestellt, und es war am 2. Januar des Jahres 1954, als Alexander früh morgens den erlösenden Anruf erhielt, dass die “Neue“ in der Nacht zuvor erblüht sei und dass sich die Blume noch in gutem Zustand befinde. Darüber hinaus, so bemerkte der anrufende Gärtner eher nebenbei, sei die Blüte eine absolute Schönheit.
In diesem Bericht, der der Erstbeschreibung als Epiphyllum chrysocardium im 'Cactus&Succulent Journal of America' vorangeht (Alexander 1956), wird des Weiteren spürbar, wie sehr es Alexander daran gelegen war, dieses Ereignis ja nicht zu verpassen und durch gute Bilder vor Ort zu dokumentieren. Etwas später stellte Backeberg unsere Pflanze in seine 1950 aufgestellte Gattung Marniera, weil deren einzige Vertreter, Epiphyllum macropterum (Lemaire)Br.& R. wie auch die vorliegende Art, Borstendornen am Pericarpell aufweisen, die bei allen andern Epiphyllen angeblich fehlten. Dies hat sich aber als Irrtum erwiesen, und so war die Gattung Marniera Backeberg von Anfang an umstritten.

Abb.1 Selenicereus chrysocardium
Ein völlig neues Bild ergab sich, als es gelang, erstmalig eine Frucht mit keimfähigen Samen auf künstlichem Wege zu erhalten. Als Alexander die Species beschrieb, musste er noch auf Angaben über Frucht und Samen verzichten, die bis dato weder am Standort gefunden noch in der Kultur erzielt werden konnten. Auch wenn mittlerweile behauptet wird, dass die Art angeblich erneut in der Natur gefunden und aufgesammelt wurde, wofür es aber keine zuverlässigen Beweise gibt, müssen wir nach wie vor davon ausgehen, dass alle weltweit in Kultur stehenden Exemplare durch vegetative Vermehrungen vom Holotypus abstammen, also ein und demselben Klon angehören. Da die Art selbststeril ist, blieben somit alle Bestäubungsversuche untereinander ergebnislos. Die ungewöhnliche Blütezeit im Winter, wenn ansonsten kaum etwas blüht und als Kreuzungspartner in Frage kommen könnte, sowie mangelnde Kenntnisse über ihr Blühverhalten bei uns mögen weitere Gründe dafür gewesen sein, warum unser Wissen um die o.a. Details zunächst noch lückenhaft blieb.
Im Jahr 1981 gelang es mir eher zufällig, die fehlenden Angaben zu erhalten, nachdem mein Epiphyllum chrysocardium überraschenderweise eine späte Blüte im Mai gebracht hatte und sich nun endlich die Möglichkeit bot, frischen Pollen von diversen, zeitgleich in Flor stehenden Phyllokakteen (Epikakteen, Epiphyllum-Hybriden) zu Bestäubungsversuchen zur Verfügung zu haben (siehe Anm.1). Die sich über 11 Monate entwickelnde Frucht war eine große Überraschung, denn sie war - ganz untypisch für Epiphyllen - völlig in Borstendornen eingehüllt, ähnlich wie bei 'Selenicereus anthonyanus' (syn.Cryptocereus) (Alexander) Hunt, mit dem unsere Species auch das dicht bedornte Pericarpell sowie die mehr oder weniger tief eingekerbten Triebe gemein hat (siehe hierzu auch meinen Bericht in Kaktusblüte 2000: 19ff.). Dies veranlasste Kimnach (Kimnach 1991), unsere Pflanze in die Gattung 'Selenicereus' (Berger)Br.& R. zu stellen, wo sie zusammen mit der zuletzt erwähnten Art der Sektion Cryptocereus Hunt zugeordnet wurde.

Abb.2 Selenicereus chrysocardium, Frucht
'Selenicereus chrysocardium' (siehe Anm.2) ist auch ohne Blüte leicht an seinen tief, bis an die Mittelrippe gelappten Trieben zu erkennen, die, wie erwähnt, stark an Farnwedel erinnern. Im Prinzip treten derartige Sprosse auch noch bei anderen, mehr oder weniger eng verwandten Arten convergent auf, so z.B. außer bei 'Selenicereus anthonyanus' auch noch bei Epiphyllum anguliger (Lemaire) Don ex Loudon (syn Epiphyllum darrahii 'K. Schumann', Epiphyllum gertrudeanum hort.) oder bei Weberocereus imitans (Kimnach&Hutchison) Buxbaum, die allen diesen Pflanzen möglicherweise als Rankhilfen dienen, um solcherart ausgestattet dem lebensnotwendigen Licht schneller entgegen wachsen zu können. Für den “Durchschnittsliebhaber“ wirkt sich dies allerdings eher nachteilig aus, denn bei ungehindertem Wachstum können sich die ansehnlichen, bis 30 cm breiten Triebe in relativ kurzer Zeit bis in die letzten Winkel eines Kleingewächshauses ausbreiten und seinen Besitzer vor schier unlösbare Platzprobleme stellen.
Auch wenn es möglich ist, den Umfang der Pflanze durch Kultur in eher kleineren Töpfen einigermaßen unter Kontrolle zu halten, so hat dieser Umstand doch leider ihre weitere Verbreitung in unseren Sammlungen verhindert und dafür gesorgt, dass sich ihre Bekanntschaft in eher bescheidenen Grenzen hält. Dies ist umso bedauerlicher, als dass man wohl ohne Übertreibung behaupten darf, dass 'Selenicereus chrysocardium' zu den schönsten und imposantesten Blühern im Pflanzenreich zählt. Die einzelnen Blüten halten nur eine Nacht, werden 30 – 35 cm lang und - abhängig von ihrer Anzahl und dem Kulturzustand der Pflanze - fast ebenso breit und verströmen in einiger Entfernung einen leichten, süßlichen Duft. Obgleich sie “nur“ weiß sind, vermitteln sie im Zusammenwirken mit dem farblichen Kontrast ihrer zahlreichen goldgelben Filamente, auf denen große, graue Antheren mit reichlich Pollen sitzen, sowie auf Grund ihrer enormen Ausmaße ein Bild von majestätischer Schönheit. Eine ausgewachsene Pflanze in vollem Flor stellt einen unvergleichlichen Anblick dar!

Abb.3 Selenicereus chrysocardium, geöffnete Frucht
Gegen alle andersartigen Meinungen werden aber auch schon kleine Pflanzen ab ca. 70 – 80 cm Höhe blühfähig, wenn man ihnen die richtige
Pflege zukommen lässt. Um eine Blühinduktion zu erzielen, ist es absolut notwendig, der Pflanze im September/Oktober eine Ruhepause zu gönnen,
in der man mit der Gießkanne vorsichtiger umgehen und wenn irgend möglich für niedrigere Wärmegrade sorgen sollte, die sich aber bei uns angesichts
des sich nahenden Herbstes meist von allein ergeben. An heißen Tagen ist es zudem von großem Vorteil, für eine deutliche nächtliche Absenkung
zu sorgen, indem man dann z.B. alle Türen und Fenster aufstellt. Solange es tagsüber wieder warm genug wird, sind größere Temperaturdifferenzen nun
genau das Richtige für einen Knospenansatz, mit dem ab Ende Oktober zu rechnen ist. Jetzt sollten die Temperaturen bei maßvollen Wassergaben ständig
bei ca. 16 – 18° C gehalten werden, damit sich die Blüten langsam entwickeln können. Jegliche Kälteschocks sind in dieser Zeit zu vermeiden, denn sie
führen unweigerlich zum Abfall der Knospen. Dies ist beispielsweise der Hauptgrund dafür, warum unsere Pflanze im “gelobten“ Kalifornien, wo Phyllos
und andere epiphytischen Kakteen in den südlichen Landesteilen meist ganzjährig in Gartenkultur gehalten werden können, selten zur Blüte kommt. Nachdem
sie im frühen Herbst reichlich Knospen gebildet hat, kann es auch dort im November/Dezember empfindlich kühle Nächte nahe 0° C geben, womit dann alle
Blütenträume für ein weiteres Jahr mit vielleicht besseren äus-
seren Bedingungen begraben werden müssen. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum sich das Gerücht, unsere Pflanze sei blühfaul, so hartnäckig hält. Nach der winterlichen Blüte sollte eine zweite Ruheperiode folgen. Gemäß ihrer tropischen Herkunft aus dem Bundesstaat 'Chiapas', Mexiko, sind jetzt ca. 14 - 16° C bei minimaler Feuchtigkeit ausreichend, wobei kurzzeitige Unterschreitungen dieser Wärmegrade nicht gleich sichtbare Schäden hervorrufen. Wenn sich im Frühjahr erneutes Wachstum zeigt, wird langsam wieder mehr gegossen. Etwas später kommt dann die Zeit, der Pflanze alles zu geben, was sie jetzt zum Leben braucht – reichliche Wasser- und Düngergaben, wenn entsprechend günstige Temperaturen herrschen, die gern 30° C überschreiten dürfen. Dabei muss gut gelüftet und über Mittag leicht schattiert werden. Dies sind die entscheidenden Monate, in denen unsere Art wachsen soll, um die nötige Kraft zu tanken, später im Jahr ihren eindrucksvollen Flor zu zeigen. Dabei habe ich für all diejenigen, die kein Gewächshaus ihr Eigen nennen können, vielleicht noch ein kleines Trostpflaster parat: Meine besten Erfolge hatte ich, als ich noch in einem Mietshaus in Rheinhessen wohnte. Hinter einer sich über zwei Stockwerke erstreckenden Südwand aus Glasbausteinen mit entsprechend diffusen, aber sehr hellen Lichtverhältnissen sowie einer eingebauten, großzügig bemessenen Lüftungsklappe blühte und gedieh mein Exemplar besonders gut wie später niemals wieder, auch nicht im Glasshaus!
Wer glaubt, den erforderlichen Platz zu haben und die nötigen Kulturverhältnisse schaffen zu können, sollte nicht lange zögern und versuchen, Selenicereus chrysocardium für seine Sammlung zu beschaffen. Wer einmal die herrlichen Blüten um die Weihnachts- und Neujahrszeit erlebt hat, möchte diese Attraktion in Zukunft bestimmt nicht mehr missen.
Anmerkung 1: Dabei ist es völlig unbedeutend, wer als Pollenspender gedient hat. Sofern die Bestäubung erfolgreich war, werden Frucht und Samen morphologisch wie bei der Mutterpflanze zur Ausbildung kommen.
Anmerkung 2: Da das lateinische Epitheton “chrysocardium“ substantivisch und nicht, wie man annehmen könnte, adjektivisch angewendet wird, folgt es nur scheinbar nicht den lateinischen Grammatikregeln, nach denen sich die Endungen eines Adjektivs (= Artname) dem Geschlecht des Substantivs (= Genusname) anzupassen haben. Die Bezeichnung Selenicereus chrysocardium (bzw. Marniera chrysocardium) ist also korrekt und hieße dann in der wörtlichen Übersetzung etwa “Goldherz-Selenicereus“ oder “Selenicereus mit dem goldenen Herzen“, eine Anspielung auf die zahlreichen goldgelben Staubfäden im “Herzen“, also in der Mitte der Blüte.
| Literatur | ||
|---|---|---|
| Alexander, E.J. (1956) : | Epiphyllum chrysocardium – A New Species, Cact.Succ.J.(US.) 28(1) : 3 – 6 | |
| Eden, R. (2001) : | Selenicereus chrysocardium, ESA-Bull. 56(3): 36 – 38 | |
| Kimnach, M. (1991) : | Selenicereus chrysocardium (Alexander)Kimnach comb.nov., in: Hunt/Taylor: Notes on miscellaneous genera of Cactaceae, Bradleya 9/91 : 91 | |
| Meier, E. (1981) : | Zur Kultur und zum Blühverhalten von Epiphyllum chrysocardium, Kakt.and.Sukk. 32(6) : 121 – 124 | |
| Meier, E. (1983) : | Zur Taxonomie von Epiphyllum chrysocardium, Kakt.and.Sukk. 34(12) : 278 – 282 | |
| Meier, E. (1986) : | Epiphyllum chrysocardium, Kakteenkartei 86/22 | |
Der Artikel 'Selenicereum chrysocardium(Alexander) Kimnach', wurde 2004 in der 'Kaktusblüte' der Wiesbadener Kakteenfreunde veröffentlicht. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Redaktion der Kaktusblüte.