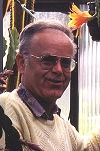Hylocereen gehören für gewöhnlich zu den Pflanzen, um die die meisten Kakteenfreunde einen großen Bogen machen. Dies ist auch irgendwie verständlich, da ihre viele Meter lang werdenden Triebe eine Unterbringung im Gewächshaus oder Wintergarten fast zwingend erforderlich machen und dort in kurzer Zeit oft genug einen Großteil des zur Verfügung stehenden, stets knappen Kulturraumes für sich beanspruchen. Hinzu kommt, dass die meisten dieser Ranker dank ihrer Herkunft aus vorwiegend tropischen Tiefländern höhere Überwinterungstemperaturen benötigen, so dass sich ihre Haltung heutzutage außerhalb einiger botanischer Gärten oder ähnlicher Institutionen angesichts drastisch gestiegener Energiekosten als kaum empfehlenswert anbietet. Ihre vermeintlich ausschließlich weißen und zudem auch noch sehr kurzlebigen und zumeist erst an älteren Exemplaren sich einstellenden Nachtblüten sind auch nicht gerade dazu angetan, das Interesse an diesen Pflanzen aus rein liebhaberischer Sicht bei einer breiteren „Fangemeinde“ zu wecken. Als Folge hiervon sind Hylocereen bei den Liebhabern kaum bekannt, wenn man einmal von Hylocereus undatus absieht, dessen Eignung als hervorragende Pfropfunterlage etwa bei der Aufzucht von Jungpflanzen sich inzwischen herumgesprochen haben dürfte. Wer jedoch irgendwann einmal die Gelegenheit hatte, auch deren schönen, vielfach duftenden, unglaublich groß werdenden und dennoch wohl geformten, eleganten Blumen mit eigenen Augen zu sehen, der wird sich möglicherweise spontan zu den wenigen „Verrückten“ hingezogen fühlen, denen diese Geschöpfe seither nicht mehr aus dem Sinn gehen. Wer über die nötigen Unterbringungsmöglichkeiten verfügt und sich an den erwähnten Einschränkungen nicht stört oder zu stören braucht, der sollte es unbedingt auch einmal mit diesen Pflanzen versuchen, die gar nicht so einheitlich und uniform in ihrem Erscheinungsbild und in der Kultur sind, wie sie sich in der Vorstellungswelt der meisten Kakteenfreunde möglicherweise darstellen.

Abb. 1 Hylocereus ocamponis
Da gibt es z.B. den Hylocereus ocamponis (S.-D.)Br.& R. (Abb. 1), der schon sehr früh und bereits bei einer Trieblänge von unter einem Meter seine weißen, 25 cm breiten Blumen bringen kann, die mit zunehmendem Alter der Pflanze noch an Größe zulegen können. Sein sehr naher, sich in dieser Hinsicht ähnlich verhaltender Verwandter, Hylocereus purpusii (Weing.)Br.& R. (Abb. 2), fällt auf durch kräftig gelbe, rot gerandete äußere Perianthblätter, die wunderschön zum Weiß der inneren Blütenkrone kontrastieren. Eine kulturwürdige Hybride mit Selenicereus grandiflorus (L.) Br.& R., x Hyloselenicereus ’Kesselring’ (syn. ’Kesselring´sche Hybride´), stellte ich in einer früheren Ausgabe dieser Zeitschrift mit Wort und Bild bereits vor (Meier 2001a). Alle drei vertragen auch einmal niedrigere Wintertemperaturen von ca.12 Grad, für kurze Zeit auch darunter, wenn sie trocken gehalten werden.
Dies gilt erst recht für Hylocereus undatus (Haw.)Br.& R. (Abb. 3), der es eigentlich nicht verdient hat, nur als Pfropfunterlage in unseren Sammlungen präsent zu sein. Unter mediterranen Bedingungen als
bedingt winterhart geltend macht es ihm kaum etwas aus, unter unseren Klimabedingungen kurzfristig auch einmal Temperaturen von nur wenigen Graden über dem Gefrierpunkt auszuhalten, wenn das Gießen rechtzeitig eingestellt wurde. Jeder hat möglicherweise im Supermarkt schon einmal mit seinen massigen, roten Früchten, den sog. „Pitahayas“ oder „Dragon Fruits“ Bekanntschaft gemacht, aber seine riesigen, im Einzelfall bis fast 40 cm breiten, äußerst imposanten, wohl riechenden Nachtblüten dürften bislang wohl nur die wenigsten „in natura“ gesehen haben, da sie leider erst an großen Exemplaren zu bewundern sind.
Wer des Weiteren das Glück hatte, den allerdings wärmebedürftigeren
Hylocereus monacanthus (Lem.)Br.& R. von der Karibik-Insel Tobago irgendwo ausfindig zu machen, der wird gewiss begeistert sein von seinem attraktiven Flor, der sich zweifarbig weiß mit ausgeprägt rosafarbenem Blütengrund höchst eindrucksvoll in Szene zu setzen vermag (Abb. 4).

Abb. 2 Hylocereus purpusii
Die Zusammenstellung besonderer Hylocereen wäre jedoch unvollständig, würde man nicht auch noch Hylocereus stenopterus (Web.)Br.& R. erwähnen, der aus den innertropisch-warmen Tiefländern Costa Ricas stammt und somit ganzjährig eine feucht-warme Gewächshausunterbringung bei Mindesttemperaturen von ca. 18°C verlangt. Diese Bedingungen sind jedoch heutzutage mehr denn je nur unter hohem Kostenaufwand zu erfüllen, womit sich seine langjährige, erfolgversprechende Haltung bei privaten Liebhabern fast verbietet. Dabei hat diese Art einige Besonderheiten aufzuweisen, die sie von allen anderen Spezies der Gattung unterscheidet und ihr eine gewisse Sonderstellung einräumt. Ihre Blüten sind mit 12 bis 15 cm Länge und Breite zwar immer noch ansehnlich groß, jedoch deutlich kleiner als bei allen anderen Vertretern des Genus´ mit Ausnahme von Hylocereus minutiflorus (Br.& R.) Br.& R. (syn. Wilmattea minutiflora Br.& R.), dessen vergleichsweise winzigen 8 cm-Blüten außerdem zu den kurzlebigsten zählen. Darüber hinaus bringt Hylocereus stenopterus - völlig untypisch für Rankcereen - sternförmige, kräftig purpurne Blüten hervor (Abb. 5), die bis in den folgenden Morgen voll geöffnet bleiben und je nach herrschenden Temperaturen sogar noch einige Zeit bei vollem Tageslicht bewundert werden können. Bunte Nachtblüten machen eigentlich keinen Sinn, da Farben bei Dunkelheit visuell nicht wahrgenommen werden können. Vielleicht soll hiermit erreicht werden, dass nicht nur Nachtfalter oder Fledermäuse, die durch den für menschliche Nasen allerdings fast nicht wahrnehmbaren Blütenduft in der Dunkelheit der Nacht angelockt werden, als Bestäuber in Frage
kommen, sondern auch frühaktive Taginsekten, für die der auffällige Flor jetzt kaum zu übersehen ist. Dies gewährleistet eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Bestäubung, so dass die Art in ihrem Fortbestand letztendlich besser abgesichert ist. Es ist nur schade, dass diese bemerkenswerte Pflanze auf Grund ihrer Ansprüche bei uns kaum vertreten und damit weitgehend unbekannt geblieben ist. Für den interessierten Liebhaber ergeben sich aber seit kurzem ein paar sehr schöne, in ihrem äußeren Erscheinungsbild recht ähnliche Alternativen zu ihr, die als direkte Arthybriden ungleich robuster in der Kultur sind und zudem noch mit weiteren Vorteilen aufwarten können, ohne auch nur das Geringste an Attraktivität einzubüßen.
Im Sommer 1987 ergab es sich rein zufällig, dass Hylocereus stenopterus und Hylocereus undatus in meinem Gewächshaus zur gleichen Zeit blühten. Damit bot sich mir erstmalig die Gelegenheit, durch Kreuzbestäubung eine Stenopterus-Frucht zu erhalten, an der ich schon seit längerem interessiert war, da in der Literatur z.T. nur sehr widersprüchliche Angaben über sie zu finden sind. Bei den meisten Pflanzen, darunter auch den Kakteen, spielt es dabei keine Rolle, wer jeweils als Pollenspender fungiert hat, denn die nach erfolgreicher Bestäubung sich bildenden Früchte und Samen fallen morphologisch stets arttypisch wie bei der Mutterpflanze aus. Das Vorhaben gelang ohne jegliche Schwierigkeiten und brachte einige Monate später die von mir angestrebten Informationen (Abb. in Meier 2001 b).

Abb. 3 Hylocereus undatus

Abb. 4 Hylocereus monacanthus, Foto R. Bauer
Eigentlich hatte ich nicht vor, auch noch die in der Frucht zahlreich enthaltenen Samen auszusäen, da ich keinen zusätzlichen Raum für solche Unterfangen „opfern“ wollte, wohl wissend, dass Sämlingsaufzuchten dieser Art mein Gewächshaus über kurz oder lang in einen undurchdringlichen Dschungel verwandeln könnten. Andererseits bot sich hier die einmalige Gelegenheit, eine noch nie zuvor gemachte Kreuzung konsequent zu Ende zu führen, wobei ich natürlich hoffte, die eine oder andere kulturwürdige Hybride als Ergebnis meiner Bemühungen zu erhalten, was mir angesichts der beteiligten sehr unterschiedlichen Eltern auch nicht ganz abwegig zu sein schien. Ich hoffte auf robustere Nachkommen mit großen, Blüten nach Art des „Vaters“ kombiniert mit der anmutigen Gestalt und dem auffälligen Rot des mütterlichen Flors. Aus Erfahrung wusste ich jedoch, dass Wunsch und Wirklichkeit bei der Pflanzenzucht meist weit auseinander klaffen, und es mehrerer glücklicher Zufälle bedarf, um ideale Ergebnisse wie diese zu erzielen, zumal, wenn sie sich möglichst auch noch in der unmittelbar folgenden Generation einstellen sollen. Das Hauptproblem dabei ist, dass man bei sehr groß werdenden Pflanzen wie diesen aus Platzgründen nur verschwindend wenige Sämlinge aus der Vielzahl der Nachkommenschaft groß ziehen kann. Hierbei nun auch noch die „richtigen“ mit den gewünschten Eigenschaften zu selektieren, ist pure Glückssache und kommt einem reinen Lotteriespiel gleich. Die einzige Möglichkeit, eine gewisse Vorauswahl zu treffen, liegt theoretisch darin, die wüchsigsten und gesündesten Keimlinge aus der Saatschale auszusondern und groß zu ziehen. Man kann dann immerhin mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Pflanzen später auch über die relativ besten vegetativen Eigenschaften verfügen und sich vermutlich am unempfindlichsten gegenüber Widrigkeiten aller Art zeigen werden. Darüber hinaus sind weitere Einflussnahmen des Züchters auf das spätere Werden „seiner“ Hybriden unmöglich, und es bleibt nur noch die über Jahre andauernde Spannung und Hoffnung, dass sich alle übrigen, im Stillen gehegten Erwartungen zumindest teil-
weise erfüllen mögen.
Obgleich die nach der Aussaat zahlreich erschienenen Sämlinge unter gleichen Bedingungen kultiviert wurden, taten sich drei durch besonders gutes Wachstum hervor, die dann zusammen mit vier weiteren, nicht besonders auffälligen Keimlingen selektiert und in den folgenden Jahren groß gezogen wurden. Das erstgenannte Trio übertraf seine Geschwister dabei nach wie vor durch geradezu rasante Größenzunahmen, so dass einer von ihnen bereits im Sommer des Jahres 1996 - inzwischen mehrere Meter lang - zum ersten Mal blühte, während die andern beiden in den nächsten zwei Jahren folgten. Alle Drei blühten seitdem regelmäßig und gemäß ihrer fortschreitenden Größe mit nahezu überproportional gesteigerter Blütenanzahl, von diesbezüglich sehr geringen individuellen Unterschieden einmal abgesehen. Was mich aber am meisten begeistert, sind die Blumen selbst, die in ihrer Form und Farbe denen ihrer „Mutter“ sehr ähnlich sind, jedoch doppelte Größe erreichen können und mit ihrem zahlreichen Erscheinen ein ebenso imposantes wie spektakuläres Bild abgeben. Als zusätzlicher Bonus hat sich bei ihnen in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie außerdem die Robustheit von Hylocereus undatus geerbt haben und sich völlig unbeeindruckt gegenüber niedrigen Wintertemperaturen zeigen, wenn sie entsprechend vorbereitet und trocken gehalten werden. Bei mir im Gewächshaus waren Temperaturen bis hinunter zu 4-6° C überhaupt kein Thema und von Kakteenfreunden in Spanien hörte ich, dass ihnen sogar leichte Nachtfröste bisher nichts haben antun können, worauf ich es aber unter unseren heimischen, eher feucht-kalten Winterbedingungen nicht ankommen lassen möchte. Der Vollständigkeit halber muss noch erwähnt werden, dass sich die anderen vier Sämlinge von Anfang an als viel weniger wüchsig und im Allgemeinen empfindlicher erwiesen haben, so dass sie in ihrer ganzen Entwicklung in auffälliger Weise hinterherhinkten. Von ihnen hat nur ein einziger Klon bei Freunden in Spanien und Texas überlebt, die bis zum heutigen Tag noch auf seinen ersten Flor warten.

Abb. 5 'Hylocereus stenopterus

Abb. 6 Hylocereus x stendatus ´Connie Mayer´
Die beiden ErstblĂĽher wurden von mir als Mitglieder einer neuen Hylocereus x stendatus -Kultivargruppe in der
KuaS vorgestellt (Meier 2001 b) und erhielten die Namen ’Connie Mayer’ (Abb.6) und ’Kathie Van Arum’ (Abb.7). Der Dritte im Bunde gesellte sich wenig später noch dazu und wurde von mir ’Bruni’ (Abb.8) genannt. Letzterer blühte zwar wiederholt in meinem Gewächshaus, jedoch ausgerechnet immer während meiner Urlaubszeit, als ich nicht zu Hause war. Bevor ich mein Glashaus wegen Umzugs aufgeben musste, wurden von allen Klonen ausreichend viele Stecklinge an Freunde und Gärtnereien im In- und Ausland verteilt, so dass ihr Fortbestand gesichert ist. Die ’Connie Mayer’ und ’Kathie Van Arum’ wurden außerdem im Huntington Botanical Garden, San Marino, Kalifornien vermehrt und im Jahre 2007 als “International Succulent Introductions“ (ISI) vorgestellt (allerdings mit den Elternpflanzen in inkorrekter Reihenfolge), wodurch sie einem noch größeren Interessentenkreis zugänglich gemacht wurden (siehe hierzu auch C&SJ(Am.)79(2):75).
Auch ich weiß eine Naturform jederzeit sehr zu schätzen, aber wer nicht die nötigen, wie in diesem Fall sehr anspruchsvollen Kulturvoraussetzungen für sie bieten kann oder will und nichts gegen Hybriden einzuwenden hat, der hat jetzt die Möglichkeit auf Pflanzen auszuweichen, die ihren natürlichen Ausgangsarten in fast allen Belangen überlegen sind. Durch geschickte Sämlingsauswahl und mit einem großen Quantum an Glück ist es mir gelungen, ein paar bemerkenswerte Hylocereus-Hybriden heranzuziehen, die es bisher noch nicht gegeben hat. Dass sich dabei ausgerechnet nur die erstrebenswerten Eigenschaften der beiden elterlichen Kreuzungspartner auf die erwähnten drei Nachkommen vererbt haben, ohne dass sich deren Nachteile in irgendeiner Weise bemerkbar
Alle drei Klone verfügen über Eigenschaften, die zu etwa gleichen Teilen vom mütterlichen wie väterlichen Elter herrühren, was auf einen im Wesentlichen intermediären Erbgang schließen lässt. Als Folge davon unterscheiden sie sich in der F1-Generation, wie zu erwarten, äußerlich auch nur relativ geringfügig voneinander, wenngleich nicht zu verkennen ist, dass bestimmte Details bei der einen oder anderen Pflanze individuell markanter in Erscheinung treten können. Wie weiter oben bereits erwähnt, haben alle die Härte und Unempfindlichkeit des Pollengebers geerbt, wobei die Natur es aber in dieser Beziehung ganz besonders gut mit der ’Connie Mayer’ gemeint zu haben scheint. Was die Größe der Blumen angeht, so nehmen sie grundsätzlich eine Art Mittelstellung ein; sie werden entschieden größer als bei Hylocereus stenopterus, ohne allerdings die Ausmaße beim anderen Partner zu erreichen. Geht man von Einzelblüten aus, übertrifft die ’Kathie Van Arum’ mit teilweise über 30 cm Durchmesser ihre beiden Geschwister in dieser Hinsicht um einige Zentimeter, aber solche Angaben relativieren sich meist „in der Praxis“, wenn man bedenkt, dass die Größe des Perianths nicht nur genetisch vorbestimmt ist, sondern erfahrungsgemäß auch in Abhängigkeit von der jeweiligen Blütenanzahl sowie vom Kulturzustand der Pflanze zu sehen ist. Dies gilt sinngemäß auch für die Intensität der Blütenfarbe, deren Rot unter den geschilderten Umständen bei der ’Connie Mayer’ meist am kräftigsten ausfällt. Die Spitzen und die Ränder der inneren Perianthabschnitte sind bei allen Dreien jedoch mehr oder weniger hellrosa bis hin zu fast weiß - am auffälligsten bei der ’Kathie Van Arum’ - , was sicherlich auf den Einfluss von Hylocereus undatus zurückzuführen ist.

Abb. 7 Hylocereus x stendatus ´Kathie van Arum´

Abb. 8 Hylocereus x stendatus ´Bruni´
Wer über genügend Platz im gut belüfteten Gewächshaus verfügt und die Pflanzen frei ausgepflanzt am Spalier kultiviert, wird in wenigen Jahren große Exemplare heranziehen können, die an Blühwilligkeit keinerlei Wünsche offen lassen. Von Mitte Juni bis in den Herbst hinein erscheinen auch hierzulande Dutzende dieser eindrucksvollen Blüten, die zwar nur vom zeitigen Abend bis in den frühen, hellen Tag hinein halten, dafür aber für gewöhnlich remontierend in mehreren Schüben pro Saison erscheinen. Freunde in Spanien und Kalifornien teilten mir begeistert mit, dass beispielsweise die ’Bruni’ als relativ kleinblütigster Geschwister im Alter u.U. mehrere hundert Blumen - jede von ihnen immerhin noch zwischen 20 und 25 cm breit - über den Sommer zu bringen in der Lage sei (Abb. 9 u. 10) und in dieser Beziehung alles weit in den Schatten stelle, was ansonsten noch an Rankern und ähnlichen Pflanzen in ihren Sammlungen existiere. Dies alles, so meine ich, sollte Anreiz genug sein, unter den gegebenen Voraussetzungen vielleicht auch einmal einen eigenen Kulturversuch mit diesen Blendlingen zu starten. Möglicherweise könnte der eine oder andere sich überdies sogar dazu entschließen, durch erneute Kreuzung untereinander eine F2-Generation zu schaffen, in der potentiell ein noch viel breiteres Spektrum an verschiedenartigen, schönen und kulturwürdigen Hylocereus x stendatus-Hybriden schlummern dürfte.

Abb. 9 Hylocereus x stendatus ´Bruni´
| Literatur | ||
|---|---|---|
| Meier, E. (2001 a): | Die Kesselring’sche Hybride; Kaktusblüte Apr.2001 : 1 u.38 | |
| Meier, E. (2001 b): | Eine neue Hylocereus-Cultivar-Gruppe; KuaS 52(6) : 141-144 | |
| Bauer, R. (1996): | Hylocereus stenopterus aus Costa Rica - Ein seltener Gast in unseren Sammlungen; EPIG 8(4): 120-123 | |
| Bauer, R. (2005): | Hylocereus ocamponis; EPIG 16(2): 60-65 | |
| Herbel, D. (1990): | Hylocereus purpusii; KuaS-Kakteenkartei 1990/7 | |
| Hofacker, A. (1999): | Hylocereus undatus; KuaS-Kakteenkartei 1999/4 | |
| Meier, E. (1978): | Meine Erfahrungen mit Hylocereus undatus; KuaS 29(1): 14-16 | |
| Meier, E. (1985): | Hylocereus stenopterus, ein seltsamer Gast aus Costa Rica; KuaS 36(7): 134-139 | |
| Meier, E. (2006): | Noch einmal Hylocereus ocamponis; EPIG Nr.56: 24-26 | |
Der Artikel 'Kulturwürdige Hylocereen', wurde 2009 in der 'Kaktusblüte' der Wiesbadener Kakteenfreunde veröffentlicht. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Redaktion der Kaktusblüte.